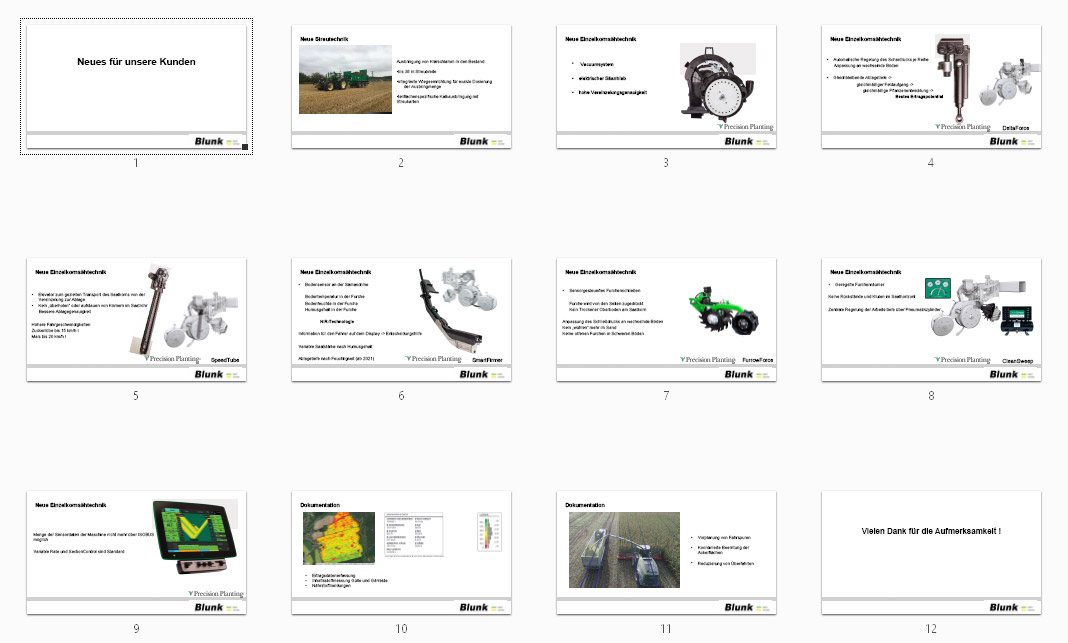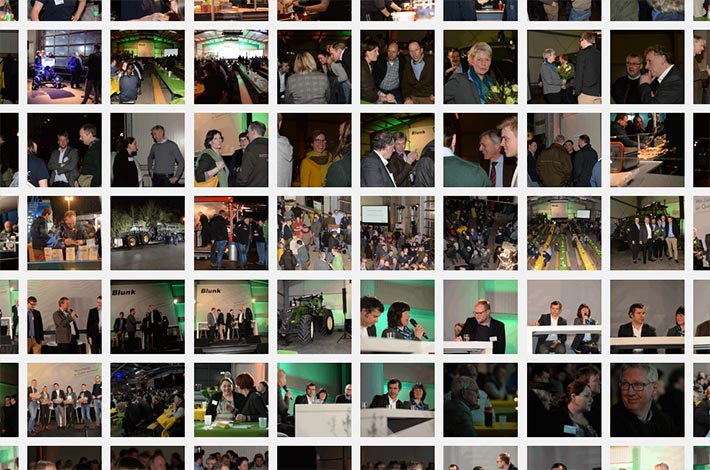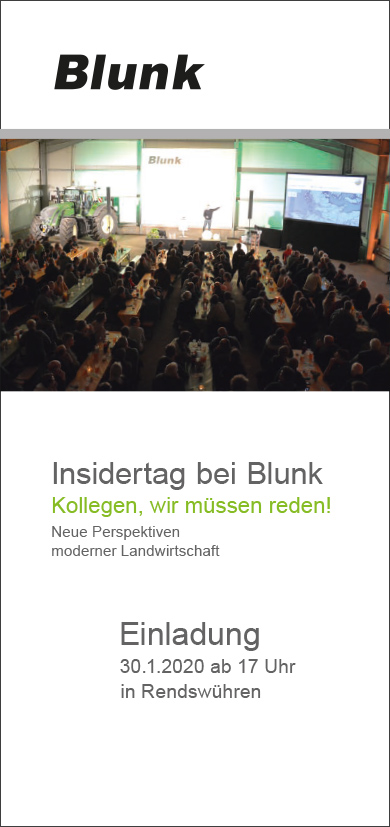Blunk-Insidertag: Rückblick auf Fachveranstaltung am 30. Januar 2020

Kollegen, wir müssen reden!
Neue Perspektiven moderner Landwirtschaft
Blunk-Insidertag 2020
Sehr geehrte Blunk-Kunden,
sehr geehrte Kollegen!
Am 30.1. durften wir rund 400 Gäste zu unserem Blunk-Insidertag 2020 auf unserem Betriebsgelände in Rendswühren begrüßen.
Unter dem Motto „Kollegen, wir müssen reden“ diskutierten wir auf diesem 6. Blunk-Insidertag,
- was wir gegen die Entfremdung von Landwirten und Verbrauchern tun können,
- wie wir unsere Arbeit Branchenfremden näher bringen und die Nachfolge-Generation für die Landwirtschaft begeistern können und
- wie wir den gesellschaftlichen und medialen Diskurs über die Moderne Landwirtschaft aktiver mitgestalten können.
Dokumentation der Vorträge und der Podiumsdiskussion
- Jonas Ostermann (Blunk-FAchberater Agrar) stellte unsere neuesten Investionen in noch effizientere Blunk-Technik für die Saison 2020 vor.
- Gastredner, Dr. Andreas Müller lieferte uns inspirierende und zuweilen auch etwas provozierene Einsichten in die derzeitigen Auseinandersetzungen ziwschen Öffentlichkeit, Politik und Landwirtschaft.
- Namhafte Podiumsgäste diskutierten anschließend einzelne Aspekte der Zukunft moderner Landwirtschaft.
Die Zusammenfassungen finden Sie nebenstehend.
Klicken Sie einfach auf die Reiter!
Neue Technik bei Blunk
Jonas Ostermann, Fachberater Agrar, stellte die neuesten Investitionen von Blunk in noch effizientere Agrar-Technik für die Saison 2020 vor.
Laden Sie sich hier die Präsentation gern herunter (pdf, 885 KB)
Vortrag Dr. Andreas Möller: “Landwirtschaft und Öffentlichkeit”
Zündstoff und vielfältige Anregungen für die Landwirte lieferte der nun folgende Gastvortrag von Dr. Andreas Möller. Der Autor des viel diskutierten Buches „Zwischen Bullerbü und Tierfabrik“ (Gütersloher Verlagshaus, 2018) beleuchtete verschiedene Aspekte der Wahrnehmung der Landwirtschaft und ihrer Akteure in der Öffentlichkeit und Politik. Nachfolgend haben wir für Sie die wichtigsten Abschnitte des Vortrags zusammengefasst.
Weitere Technologisierung der Landwirtschaft
Möller stellte fest, dass wie in anderen Branchen, auch in der Landwirtschaft eine rasant sich weiter entwickelnde Technologisierung zu beobachten ist. Nicht nur auf Fachmessen wie der Agritechnica ist zu erleben, wie sehr Technologie und Wissenschaft die Basis moderner Lebensmittelproduktion bilden. Ob es die Landwirtschaft in den westlichen Gesellschaften in 50-60 Jahren noch so, wie wir sie derzeit kennen, geben wird, wird aber nicht allein von technischen Entwicklungen abhängen oder inwieweit wir den CO2 Ausstoß in den Griff bekommen, sondern von der gesellschaftlichen Akzeptanz.
Überwindung der Ängste
Wovor fürchten wir uns, insbesondere “die Städter”, was bewegt die Gemüter, und warum bewirken in der aktuellen Debatte rationale Argumente so wenig? Laut Möller mangelt es nicht an Aufklärung und Information. Aber entscheidend für jede Akzeptanz von neuen Technologien – wie einst der Otto Motor, die Kraftwerke oder heute die Gentechnologie – sind nicht rationale Argumente, sondern die Überwindung emotionaler Ängste und subjektiver Sorgen der Menschen.
Überholte Vorstellungen von Land und Landwirtschaft
Während “Wir fahren zu Oma” vor 30 Jahren einen Ausflug aufs Land ankündigte, so erzählte Möller, meint “Wir fahren zu Oma” heute meistens eine Fahrt zum Pflegeheim in der Stadt. Wir klammern uns dennoch an ein überholtes Bild von “auf dem Land” und “Landwirtschaft” aus dem 19. Jahrhundert – wobei wir die Mühsal des damaligen Landlebens vollständig ausklammern.
Als weiteres Indiz für dieses Phänomen nannte der Referent den Erfolg von Zeitschriften wie z.B. “Landlust”, “Landliebe”, “Heimat” oder “Mein schönes Land”. Während Tageszeitungen mit sinkenden Nachfragen von bis zu 30% zu kämpfen haben, liegt die Landlust (Landwirtschaftsverlag Münster) mit einer Auflage von über einer Million sogar über denen des Spiegels oder des Sterns.
Landwirtschaft im Spannungsfeld von Gesetzen, Geiz und globalem Markt
Worin liegen eigentlich die derzeitigen Hauptprobleme in der Landwirtschaft? Laut Möller finden wir die in einem Spannungsfeld von
- 1. einem wachsenden regulatorischen Rahmen, der seit Jahren enger wird (Stichwort Düngeverordnung),
- 2. inzwischen liberalisierten Märkten und
- 3. sinkenden Erzeugerpreisen
Ermüdung und Polarität in der öffentlichen Debatte
Des weiteren nimmt der Autor des Buches “Zwischen Bullerbü und Tierfabrik” eine gewissse Ermüdung bei der Landwirtschaft in Bezug auf die Öffentlichkeit wahr. Gleichzeitig haben die Polarität und die Schärfe und die häufig unsachliche Debatte in der Öffentlichkeit zu einer großen Gereiztheit insbesondere in den Sozialen Medien geführt. Außerdem gilt es angesichts des allgemeinen und subjektiven Krisenempfindens inzwischen als politisch hoffähig, undifferenziert zu reden – und sogar regelwidrig zu handeln.
Persönlicher Bezug verändert Entscheidungen
In der Bevölkerung stoßen grundsätzliche Debatten über “Artenvielfalt: Ja oder Nein?” auf zunehmend gereizte und taube Ohren. Nur wo persönliche Betroffenheit erkennbar ist, entsteht noch Interesse. Botschaften, die einen individuellen Bezug herstellen, im Sinne von “Artenvielfalt, was bedeutet das eigentlich konkret für mich? Wie betrifft mich das?” würden zu einer sehr viel differenzierteren Betrachtung in der Bevölkerung führen, sind aber selten im Sinne derer, die Kampagnen initiieren.
Bewältigung der Schattenseiten der Natur selbstverständlich
Der Zusammenhang zwischen dem, was wir auf unseren Teller legen, und der Arbeit und Not der Landwirte ist den meisten Menschen unserer Zeit nicht bewusst. Das ist u. a. eine Folge der Technologisierung und immer besseren “Bewältigung der Schattenseite der Natur” sowie der kompletten Verlagerung der modernen Nahrungsproduktion aus den Städten heraus – und damit aus unserer visuellen Wahrnehmung.
Keine eigenen visuellen Erfahrungen
Wer weiß heute wirklich,
- wie unsicher eine Ernte angesichts von Schädlingen wie dem Maiszünzler sein kann,
- was ein Mutterkorn ist oder
- was die Rückkehr zur mechanischen Bodenbearbeitung in Hanglagen und angesichts der ansteigenden Bodenpreise für die Landwirte bedeuten würde?
Kaum ein Journalist, Bundestagsabgeordneter oder Verbraucher hat jemals die verheerenden Folgen von Schädlingsbefall mit eigenen Augen gesehen. Es gibt keine visuellen Eindrücke, geschweige denn eigene Erfahrungen.
Jederzeit verfügbare makellose Lebensmittel selbstverständlich
Auch die Folgen der Dürren der letzten Jahre und die damit einhergehenden Verluste in der Getreideernte für die hiesigen Landwirte spürt die Bevölkerung nicht. Vielmehr sorgt ein ausgeklügeltes, internationales Handelssystem dafür, dass trotzdem genug Mehl in den Regalen steht. Entsprechend erachtet der Verbraucher die Verfügbarkeit von Lebensmitteln für selbstverständlich.
Undifferenzierte Proteste und Diskurse ohne persönliche Folgen
Das Verbot von Glyphosat ab 2023 ohne wirtschaftlich tragfähige Alternativen und die dem bayrischen Volksbegehren für Artenvielfalt folgenden Gesetze kosten ihn persönlich nichts. Nach dem Protest kehrt er zurück in sein hoch technisiertes Stadtleben zurück, ohne die Auswirkungen der geforderten Änderungen auf die 2 % der Bevölkerung, die in und von der Landwirtschaft leben, am eigenen Leib zu spüren.
Ähnlich wird auch auf der politischen Ebene inzwischen völlig gefahrlos und undifferenziert über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln diskutiert.
Naturliebe variabel – je nach Betroffenheit
Möller demonstriert die vorherrschende Doppelmoral der Verbraucher anhand eines aktuellen Fotos: In einer Regalwand der Gartenabteilung eines Berliner Baumarktes stehen unzählige – auch schärfste – Pflanzengifte und Insektenbekämpfungsitteln für den heimischen Garten aufgereiht. Darunter befinden sich Pflanzengifte, die vielfach konzentrierter sind als das, was Landwirte auf die Felder ausbringen. Aber dagegen protestiert niemand.
Vielmehr werden diese Mittel gekauft, weil sie uns einen direkten individuellen und persönlichen Nutzen versprechen. Plötzlich wird unsere grundsätzliche Naturliebe relativ. Die Wissenschaftler nennen dieses Phänomen den “Unterschied zwischen Nah- und Fernsicht in der Beurteilung von z.B. Technik.”
Landwirtschaft als abstrakte Größe
Wir unterscheiden insgeheim klar zwischen guter und schlechter Natur. Dort, wo wir glauben, dass ein Eingriff in die Natur uns einen persönlichen Nutzen bringt, so Möller, ist es mit unserer Naturliebe nicht weit her, z.B. bei der Bekämpfung von Krankheiten wie Krebs oder dem Einsatz von Gentechnik.
Da aber, wo kein persönlicher Bezug oder Nutzen für den Einzelnen erkennbar ist (Löwenzahn im Vorgarten beseitigt) und es für ihn aus Unkenntnis nur um etwas Abstraktes wie “das System” oder “die Landwirtschaft” geht, schwindet die Akzeptanz von Eingriffen in die Natur.
Botschaften der Landwirtschaft gehen unter
Die Informationen über moderne Nahrungsmittelproduktion und die Arbeit und Unwägbarkeiten der Landwirte berühren uns nicht im Herzen. Allenfalls nehmen wir Informationen darüber zur Kenntnis – und vergessen sie angesichts der organisierten Flut an Informationen über Klimawandel, Umweltverschmutzung und Schreckensnachrichten aus aller Welt.
Kampagnen organisieren als Geschäftsmodell
Möller weist darauf hin, dass, nüchtern betrachtet, der Anbau von Weizen genauso ein Geschäftsmodell ist, wie das Organisieren von Kampagnen in den Medien. Kommunikation ist eine Währung.
Alle Umweltverbände und grünen Initiativen beschäftigen zahllose professionelle Fachleute (Campaigner, d.h. Öffentlichkeitsarbeiter, die rechchieren, Kampagnen entwerfen und in den Medien lancieren). Deren einzige Aufgabe ist, Inhalte zu kommunizieren, sachlich fundiert aber vor allem mit auch emotional packenden Botschaften und Bildern.
Präsenz der Agrarbranche in den Medien
Die gesamte Agrarbranche inklusive der Agrar-Verbände dagegen überlässt das mediale Spielfeld bisher den anderen. Es gibt in der Branche wohl keine professionellen Campaigner, die die Anliegen der Agrarbranche in die Öffentlichkeit kommunizieren. Die Medien on- und offline werden bisher von Vertretern anderer Interessen bespielt. So bemerken wir derzeit “ein gewisses Ungleichgewicht in der Wahrnehmung”, wie es Möller vorsichtig formuliert.
Landwirtschaft politisch nicht wahlentscheidend
In diesem Zusammenhang stellt der Referent noch nüchtern fest, dass auch die politischen Wettkampfzentralen ihre Kräfte nicht nach Sachlage sondern nach Erfolgswahrscheinlichkeiten Wahlen zu gewinnen einsetzen. Ihre erste Frage lautet “Wen kann ich mobilisieren, mit welchen Botschaften?” So stellt die Landwirtschaft mit inzwischen im Kern nur noch 1,4 % der Erwerbstätigen in Deutschland gegenüber z.B. 25% der naturverbundenen Städter, die grün wählen, keine relevante Zielgruppe dar.
Strukturwandel auch in anderen Branchen und Ländern
Abschließend stellt Möller fest, dass nicht nur die Landwirtschaft von einem tiefgehendem Strukturwandel betroffen ist: “Wir alle stellen Autoritäten und das, was sich die Menschen in den letzten 100 Jahren westlicher Zivilisation aufgebaut haben,” generell in Frage.
Die Energieversorger im mitteldeutschen Revier, die Automobilindustrie im Süden oder die Kohleabbauregionen im Osten z.B. haben mit pauschalen Anfeindungen, verschärften Debatten, den Auswirkungen veränderter Wahrnehmungen und Verunsicherung in der Bevölkerung derzeit schwer zu kämpfen.
Anliegen der Landwirtschaft in größeren Zusammenhang stellen
Dabei sprechen, wie der Vortragende bemerkt, z.B. die Ministerpräsidenten in den Kohlebergbauregionen interessanterweise kaum noch direkt über Kohle, sondern vielmehr von einem “Strukturwandel” in der Region.
Analog zu diesem Beispiel bemerkt Möller abschließend: “Die Landwirtschaft wäre ganz gut beraten, ihre Anliegen auf eine höhere Ebene wie die Sicherung ländlicher Räume oder die Wahrung gleicher Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu heben”.
Zudem empfiehlt er den Landwirten, ihren Alltag transparenter zu kommunizieren, über das moderne Leben auf dem Land zu erzählen und aktiver ein berührendes Storytelling zu betreiben.
Podiumsdiskussion: “Kollegen wir müssen reden!”
Unser Kollege Philipp Staritz befragte als Moderator die Podiumsgäste zu verschiedenen, von Andreas Möller in seinem Vortrag aufgeworfenen Aspekten der derzeitigen Situation der Landwirtschaft:
Wie hat sich die Landwirtschaft entwickelt und wohin geht die Reise?
Fahje: Immer mehr Frauen studieren inzwischen Landwirtschaft oder übernehmen Betriebe. Andere heiraten in die Landwirtschaft ein, gehen aber weiter ihrem eigenen Beruf nach. Die Bilderbuchvorstellung der Bäuerin mit Kopftuch und ein paar Kühen und Schafen um sich herum, gibt es dabei nicht mehr.
Andersen: Die Zahl der Betriebe hat sich z. B. bei uns im Dorf halbiert. Wir merken den Strukturwandel schon, aber wir jungen Landwirte sehen darin auch Chancen. Dabei müssen wir aufpassen, uns nicht in eine Sache zu verrennen, sondern den Blick weit halten und nach Alternativen für uns suchen. Den eigenen Betrieb im Nebenerwerb zu betreiben, ist bei uns im Norden noch nicht so verbreitet, kann aber durchaus eine zukunftsträchtige Möglichkeit sein.
Fahje: In unseren Gemeinderäten sind viele Landwirte, aber zunehmend auch neu Hinzugezogene. Sie werden das Dorf verändern – und das ist vielleicht auch ganz gut.
Was müssen wir Landwirte zukünftig anders machen?
Andersen: Unsere Väter hatten das Ziel, die Produktion zu steigern. Die Kernaufgabe für die jungen Landwirte heute wird sein, den Dialog zu befördern, auch als Digital Natives in den Medien. Aber auch die Älteren müssen mithelfen, den Dialog aktiv zu führen, auf den Höfen, in den Supermärkten, am Feldrand. Die Erklärungsarbeit, was wir tun und warum, die kann jeder Landwirt leisten.
Hirschberg: Wir kommen aus einer Zeit, in der es hieß “Wir haben einen Bauernverband und die machen das [Öffentlichkeitsarbeit] für uns”. Aber, mit der Kommunikation kann man nicht allein die Verbände beauftragen. Vielmehr ist jeder Landwirt vor Ort gefragt, unsere Anliegen vorzubringen und zu kommunizieren.
Volquardsen: Jeder von uns wird immer als Stellvertreter aller Landwirte gesehen. So wie unser Arzt im Dorf für uns immer der Arzt ist, auch wenn er im Supermarkt steht, so sollten wir Landwirte daran denken, dass wir für das Dorf immer die Bauern sind, egal wo man uns antrifft. Deshalb sollten wir ein Vorbild sein.
Zukunftsweisend sind der im Koalititonsvertrag für S-H fest vereinbarte Bildungsauftrag und die finanziell gesicherten Schulbesuche auf Bauernhöfen für alle Kinder. So wird jedes Kind einmal selbst erleben können, wie wir leben und arbeiten. Auch in der Ausbildung des Nachwuchses können hier Weichen gestellt werden.
Ist Bio die Lösung?
Hirschberg: Ich denke nicht, dass Bio DIE Lösung ist. Aber jeder von uns muss schauen, wo er anknüpfen und lernen kann.
Gesellschaftlich bin ich der Böse, das Feindbild per sé: Landwirt, Unternehmer, Biogasanlagenbetreiber, alter weißer Mann. Auf der anderen Seite heize ich mit alternativen Energien, erzeuge mehr Strom und Lebensmittel als ich verbrauche und gehe zu Fuß zur Arbeit, ich pendele nicht und produziere wenig CO2 – damit entspreche ich dem gesellschaftlichen Ideal.
Ich bin schon erstaunt über z.B. die Forderung, dass die Landwirtschaft endlich umweltfreundlich werden muss, von jemandem der privat mit dem Auto herumfährt. Ein interessante Frage ist dabei, wie wir mit diesen unterschieldichen Schtweisen umgehen. Bio oder konservativ sind eher als Prozesse zu sehen, die wir sicher z.B. mit technischen Lösungen verbessern können.
Gibt die Landwirtschaft Kompetenz aus der Hand, wenn sie sich Fachberatung einkauft?
Volquardsen: Vor 20 Jahren sollten wir uns unbedingt spezialisieren. Heute stellen wir uns breiter auf, um besser am Markt bestehen und mit klimatischen Einbrüchen umgehen zu können. Natürlich brauchen wir dafür Fachkompetenz von außen. Die Weiterbildung ist das A&O für uns. Denn bei aller Kommunikation von Emotionen und Bildern, wie Herr Möller sagte, brauchen wir aber vor allem Fachwissen sowie Fakten.
Möller: Die Sachkompetenz ist natürlich richtig und wichtig, sie dürfen die sachliche Ebene nicht verlassen. Dennoch, sie werden einen Gegner der Veredlungswirtschaft nicht mit Fakten und Zahlen überzeugen, sondern seine Aufmerksamkeit mit Emotionen binden.
Wird die Wertschöpfung in 15 Jahren noch in der Landwirtschaft stattfinden?
Hirschberg: Wir werden auch in Zukunft in einem wirtschafltichen System arbeiten und unser Geld verdienen müssen.
Als Gemüseanbauer brauche ich Kontrakte, um mein Gemüse loszuwerden. Andererseits gebe ich wie in der Industrie auch Wertschöpfung aus der Hand. Ich bezahle Flächeneigentümer, um Größeneffekte aus dem technischen Fortschritt zu nutze. Ich hole mir adminstratorische Unterstützung und beuaftrage Lohnunternehmen mit modernen Maschinen. Aber, um all das und die vom Gesetzgeber geforderten weiteren Auflagen bezahlen zu können, müssen die Verbraucherpreise stimmen.
Ist der Einzelhandel für uns der richtige Ansprechpartner?
Möller: Konzentrationsbereiche im Einzelhandel sehen wir derzeit in jedem Bereich, die Tante Emma Läden sind verschwunden. Der LEH ist ein Spiegelbild unserer selbst, die Scanner lügen nicht. Einkaufen findet anonym statt und was die Leute tun und sagen ist Zweierlei. Seit Jahren wird erfolgreich mit Tiefstpreisen geworben. Dagegen könnte der Verbraucher andere Signale setzen, wenn er wollte.
Volquarsen: Zu hören, was der Verbraucher wirklich denkt, ist wichtig für uns. Wir in S-H haben das Glück, dass unser Minister Albrecht (Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein) sich persönlich vor Ort informiert. Wir als Direktvermarkter können zudem direkt mit den Endverbrauchern sprechen.
Land schafft Verbindung und Bauernverband: der richtige Weg?
Hirschberg: Ich sehe Land schafft Verbindung als konsequente Weiterentwicklung in unserem Bereich. Denn die Öffentlichkeit denkt, sobald sie “Bauernverband” hört, “Verbandspolitik” und wittert Lügen. Dann klappt sie die Ohren zu.
Die Landwirtschaft selbst dagegen hat einen hohen Vertrauenswert in der Bevölkerung. Die Initiative Land schafft Verbindung nutzt die eigene Kompetenz in den Sozialen Medien und der Öffentlichkeitsarbeit. Sie kann auch medial etwas bewegen und mobilisiert Öffentlichkeit und Politik. Diese Kompetenz fehlt uns im Bauernverband. Dafür hat der Verband mehr Fachkompetenz z.B. in Gesetzesvorlagen. Gemeinsam verfolgen wir dasselbe Ziel, nämlich die Sache der Landwirtschaft nach vorn zu bringen.
Die Frage zum Abschluss:
Was muss die Landwirtschaft lernen?
Volquardsen: Wir müssen in dem Veränderungsprozess der Landwirtschaft nach links und rechts schauen und dürfen nicht alles als Kritik an uns und an dem, was wir tun, sehen, sondern daraus etwas machen.
Hirschberg: Wir müssen täglich wieder lernen, uns den Rahmenbedingunen anzupassen und daraus lebensfähige Konzepte zu entwickeln und Lösungen für unsere Höfe zu finden.
Andersen: Wir sollten selbstbewusster auftreten, dem Verbraucher klar kommunizieren, was wir machen und wie und warum wir das machen. Aber wir sollten auch verstehen, dass der Verbraucher ein Interesse an günstigen Lebensmitteln hat.
Land schafft Verbindung genießt ein hohes mediales Interesse. Wir sollten unbedingt dafür sorgen, dass die Aktionen nicht eskalieren, um die erreichte Sympathie für die Landwirtschaft nicht wieder zu verspielen.
Möller: Mit dem Selbstbewusstsein und der Fähigkeit in die Öffentlichkeit zu gehen, kann man gut arbeiten. Eventuell könnte noch mit ein wenig mehr Humor und Selbstironie hinzukommen angesichts dessen, dass es anderen Branchen derzeit ähnlich wie der Landwirtschaft ergeht.
Fahje: Auch kleine Initiativen wie die App Ab aufs Land der Deichdeern zum Beispiel können Gespräche und ein Aufeinanderzugehen weiter befördern. So wird, was klein angefangen, dann auch eventuell größer.
Fotos vom Blunk-Insidertag 2020 in Rendswühren
Ausführliche Bildstrecken vom diesjährigen Insidertag 2020 finden Sie im Aktuelles-Beitrag Blunk-Insidertag 2020: Fachveranstaltung Perspektiven moderner Landwirtschaft
Programm
Blunk Insidertag
Fachveranstaltung am 30. Januar 2020
ab 17.00 Uhr
Ankunft der Gäste
VORSTELLUNG MODERNE BLUNK-TECHNIK
auf dem Betriebsgelände und in der beheizten Halle
18.00 Uhr
Beginn
BEGRÜSSUNG
Jogi Blunk
Neues für unsere Kunden, Agrar-Team Blunk
GASTVORTRAG
LANDWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHKEIT
Dr. Andreas Möller, Autor des Buches
„Zwischen Bullerbü und Tierfabrik“ (ütersloher Verlagshaus, 2018)
PODIUMSDISKUSSION
KOLLEGEN, WIR MÜSSEN REDEN
- Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer S-H, Landwirtin
- Ludwig Hirschberg, Vorstandsmitglied Bauernverband S-H, Landwirt
- Petra Fahje, Vorsitzende Land-Frauen Kreisverband Segeberg, Landwirtin
- Peter M. Andersen, Agrarausschuss Landjugendverband S-H, Landwirt, Student
- Dr. Andreas Möller, Autor
Moderation Philipp Staritz, Vertriebsleiter Agrar, Blunk
ÜBERGABE DER NEUEN FENDT-SCHLEPPER
Bern Uwe Johns und Thomas Tank, Raiffeisen Technik Westküste
Anschließend
Imbiss, Austausch und Schlepperbier!
Veranstaltungsort
Blunk GmbH
Dorfstraße 1
24619 Rendswühren
Fon (04323) 90 70 80
Fax (04323) 90 70 880
insidertag@blunk-gruppe.de